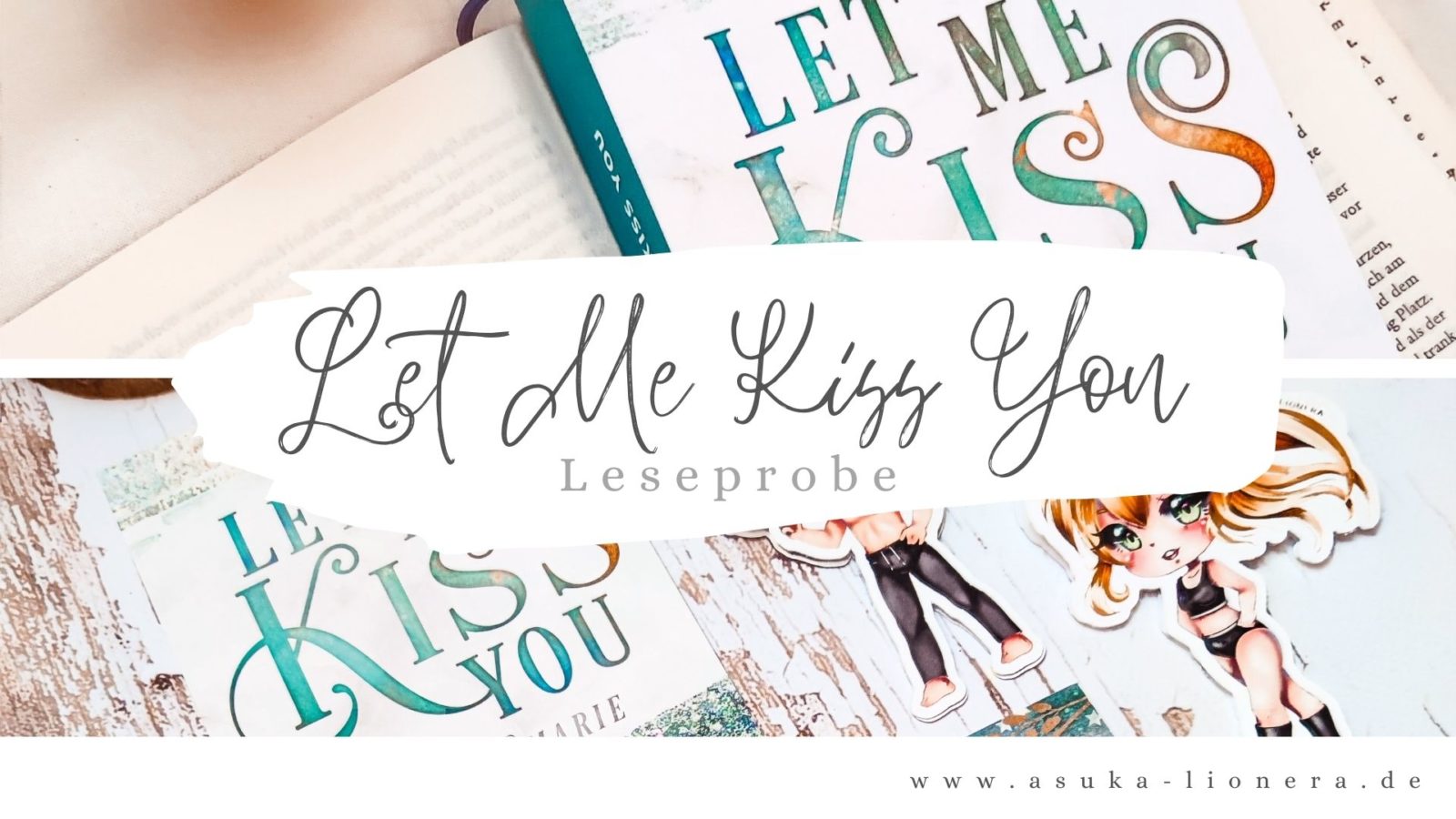Moonlight Sword 1 – Leseprobe
Mit der Leseprobe zu „Moonlight Sword: Klingenherz“ erhältst du einen Einblick in die Romantasy-Geschichte.
Prolog
Delmira
Ungeduldig wippe ich auf Vaters Schoß hin und her. »Erzähl mir die Geschichte, Papa!«
Eigentlich bin ich mit meinen fast sechs Jahren zu groß, um auf seinem Schoß zu sitzen, und zu alt, um mir Geschichten erzählen zu lassen.
Aber seit ich zurückdenken kann, ist es diese eine Geschichte, die mich immer wieder in ihren Bann zieht und mich nicht loslässt.
Vater seufzt, lächelt dabei aber, obwohl ich seine Lippen in dem dichten, dunklen Bart kaum ausmachen kann. Ich erkenne es an seinen grünen Augen, die gutmütig funkeln, und an den feinen Fältchen, die sich darum bilden.
Ich höre auf zu zappeln und warte darauf, dass Vater mit seiner Erzählung beginnt. Hinter mir knistert und knackt Holz im Kamin, dessen Feuer uns trotz der Kälte jenseits unseres Hauses eine behagliche Wärme spendet.
Meine Eltern gehören zwar nicht dem alten Adel des Reiches Bellvor an, trotzdem fließt blaues Blut in den Adern meiner Mutter, das uns einiges an Ansehen und Reichtum eingebracht hat. Wir bewohnen eine kleine Burg auf einem Hügel mit Sicht auf unsere Ländereien und beschäftigen ein paar Hausangestellte. Obwohl ich noch jung bin, weiß ich, dass es uns gut geht. Dass wir zu den Glücklichen gehören, die von der harten, kalten Welt da draußen, jenseits unserer Burgmauern, nicht viel mitbekommen. Genauso weiß ich, dass meine Eltern viel von mir abschirmen. Ich merke es, wenn sie plötzlich aufhören zu reden, sobald ich den Raum betrete, und sie nicht schnell genug ihre Mimik unter Kontrolle haben.
Was es ist, das ihnen solche Sorgen bereitet, weiß ich jedoch nicht.
»Vor langer, langer Zeit«, beginnt Vater endlich und vertreibt damit alle Sorgen, die sich sogar in meinem Kinderkopf festsetzen, »lebte ein stattlicher Prinz, dessen Name heute niemand mehr kennt. Schon in seiner Jugend wusste er, dass er zu Höherem bestimmt war. Auch weil …«
»… weil seine Weissagung so lautete, nicht wahr?«, platze ich heraus.
Ich bettele nahezu jeden Tag bei Vater um diese Geschichte. Natürlich kann ich sie bereits auswendig, aber ich will sie trotzdem hören. In ihr liegt etwas, was die unterschwellige Angst vertreibt, die langsam Besitz von unserer Burg und allen, die darin leben, ergreift – und sei es nur für die Minuten, die die Geschichte dauert. Doch während dieser Zeit mache ich mir keine Gedanken über Mutters sorgenvolle Miene oder mein Verbot, unter keinen Umständen die Burgmauern zu verlassen.
Vater lächelt mich an, während er mir über den Schopf streicht. »Genau so ist es, meine Mira. Die Priesterinnen sagten ihm eine große Zukunft voraus. Niemand kennt den genauen Wortlaut seiner Weissagung, die er – wie wir alle – mit sechzehn Jahren empfing, aber es muss damit zu tun haben.«
»Werde ich auch mit sechzehn eine Weissagung erhalten?«, frage ich.
»Natürlich, mein kleiner Spatz. Jeder hört ein Mal in seinem Leben, was die Götter für uns bereithalten. Welchen Weg sie sich für uns ausgedacht haben. Und sobald du sechzehn Jahre alt bist, wirst auch du verstehen, was der Wille der Götter ist und welchen Schicksalsgebundenen sie für dich ausgewählt haben.«
Vater hat das Wort »Schicksalsgebundenen« bereits öfters erwähnt, aber ich habe nie völlig verstanden, worum es sich dabei handelt. Es kümmerte mich auch nie.
Ich springe von seinem Schoß, husche durchs Zimmer hinüber zur Ecke hinter der Kommode, wo ich meinen wertvollsten Schatz aufbewahre: ein hölzernes Schwert, das mir Vater zu meinem letzten Geburtstag geschenkt hat – sehr zum Verdruss meiner Mutter, die der Meinung ist, ich würde nie lernen, mich wie eine Dame zu benehmen. Das Holzschwert ist perfekt auf meine Größe angepasst; in Vaters Händen sähe es eher aus wie ein zu großes Buttermesser.
Bewaffnet mit meinem Schatz eile ich zurück zu Vater und klettere wieder auf seinen Schoß, wo ich stolz das Holzschwert vor mich halte.
»Ich werde eine große Weissagung erhalten, ebenso wie der Prinz«, verkünde ich.
Nicht für eine Sekunde wankt Vaters Lächeln, als er mir über mein rostrotes Haar streicht. »Da bin ich mir sicher. Und wenn du erst, wie der Prinz, ein besonderes Schwert findest, wird deiner glorreichen Zukunft nichts mehr im Weg stehen.«
Auch diesen Teil der Geschichte kenne ich auswendig.
»Der Prinz hat ein magisches Schwert gefunden, nicht wahr?«
Vater nickt.
»Ein Schwert der Götter, gefüllt mit magischer Kraft, das ihn zu großen Taten beflügelt hat. Das Schwert trug den Namen Caligram. Viele Männer führten Caligram in der Vergangenheit. Herrscher. Könige. Eroberer. Sie alle erlangten wahre Größe mithilfe des Schwertes. Aber keiner von ihnen hatte solch ambitionierte Pläne wie der Namenlose Prinz. Denn er setzte sich in den Kopf, alle Reichen zu einen, die bis dahin von einem nicht enden wollenden Krieg verzehrt wurden. Caligram half ihm bei seinem Vorhaben.«
Mein Herz klopft bei der bloßen Erwähnung des Schwertnamens schneller.
»Wo ist Caligram jetzt? Ich könnte damit auch Großes vollbringen! Lass es uns holen, Papa!«
Diesmal wirkt sein Lächeln traurig, was ich nicht verstehe.
Ich runzele die Stirn. »Oder ist das Schwert noch im Besitz des Prinzen?«
Ein Seufzen erklingt von der Tür. Mutters Schritte werden von den dicken, dunkelroten Teppichen verschluckt, während sie auf uns zu kommt und sich hinter Vaters Sessel stellt. Ihr rotes Haar, das eine Spur heller ist als meines, schimmert im Feuerschein des Kamins. »Du musst ihr die gesamte Geschichte erzählen, Liebling.«
»Dafür ist sie noch zu klein«, verteidigt Vater sich.
Entrüstet plustere ich die Wangen auf. »Ich bin nicht klein!«
Mutter streckt die Hand nach mir aus und streichelt mir über die Stirn. »Die Geschichte des Prinzen, den du so sehr verehrst, nimmt kein gutes Ende.«
Verwirrt schaue ich von Mutter zu Vater und wieder zurück. »Aber er ist ein Prinz! Geschichten über Prinzen und Prinzessinnen enden immer gut.«
»Diese nicht«, gibt Vater zu. »Ich habe es nie über mich gebracht, dir das Ende zu erzählen, weil du den Prinzen so toll fandest.«
»Macht«, sagt Mutter, »hat immer einen Preis. Eine große Macht, wie der Besitz eines magischen Schwerts, verlangt nach Opfern und Schmerz. Erst recht, wenn derjenige, der diese Macht für sich beansprucht, seinen Teil der Abmachung nicht erfüllt.«
Meine Verwirrung wächst. »Ich verstehe nicht …«
»Der Namenlose Prinz hat das Schwert der Götter nicht einfach irgendwo gefunden«, sagt Vater. »Es gehörte einer Hexe, einer direkten Nachfahrin der Götter, die unsere Welt vor unzähligen Jahren verlassen haben. Die Hexe gab dem Prinzen das Schwert nur unter einer Bedingung.«
»Und welcher?«, will ich wissen.
Mutter schüttelt den Kopf. »Das weiß niemand. Es ist nur bekannt, dass der Prinz seinen Teil des Handels – ob bewusst oder unbewusst – nicht erfüllte. Und dafür wurde er bestraft.«
»Betraft?«, echoe ich.
»Der stattliche Prinz mit großen Ambitionen wurde besiegt und starb«, antwortet Mutter. »Die Erinnerung an ihn verschwand aus den Köpfen der Menschen, als hätte es ihn nie gegeben, und mit ihr verschwand auch sein Wunsch, die vier Reiche zu einen. Seitdem wird er bloß noch als der Namenlose Prinz bezeichnet, weil niemand mehr seinen Namen kennt.«
»Verstehst du das, Mira?«, fragt Vater, während er mich aufmerksam betrachtet. »Selbst ein angesehener Prinz muss seine Versprechen halten. Einen Eid zu brechen, bringt nur Kummer und Schmerz. Du darfst niemals etwas versprechen und es dann vergessen. Versprechen sind heilig.«
Ich nicke ernst. »Ich verstehe es, Papa.«
Doch ich habe es nicht verstanden. Das wurde mir erst später klar.
Als ich in jener Nacht keinen Schlaf fand, da mein Held sich als Eidbrecher entpuppte, schlich ich mich aus der Burg, um zu dem See zu gehen, an dem ich oft gespielt hatte, bevor meine Eltern mir verboten, das Anwesen zu verlassen. Es war eine wolkenlose Vollmondnacht und ich erinnere mich heute noch klar und deutlich an das leuchtende Spiegelbild des Mondes auf der bewegungslosen Wasseroberfläche. Dieser Anblick schenkte mir in diesem Moment eine Ruhe, die ich mit meinem kindlichen Verständnis nicht in Worte fassen konnte. Er vertrieb die Wut auf meinen einst verehrten Prinzen, der, solange ich zurückdenken konnte, mein Held war und dem ich nacheifern wollte, obwohl ich ein Mädchen war und wahrscheinlich nie ein anderes Schwert als mein Spielzeugschwert aus Holz führen würde.
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich am See saß, ehe ich mich auf den Rückweg durchs Dorf hinauf zur Burg machte. Vielleicht ein paar Stunden.
Doch es reichte aus, um das Verderben über uns zu bringen.
Die Erzählungen meines Vaters und die Vertrautheit meiner Eltern sind die letzten warmen Erinnerungen, die ich an meine Kindheit habe. Doch auch sie werden überdeckt von dem Geruch nach Blut – so beißend, dass ich ihn auf der Zunge schmecken kann. Von Kälte und Einsamkeit.
Und Schuld.
Meiner Schuld.
Weil ich mein Versprechen gebrochen hatte.
Kapitel 1
Delmira
Etwa fünfzehn Jahre später …
Die Plörre in meinem Krug schmeckt wie Pferdepisse.
Ich habe noch nie Pferdepisse getrunken – jedenfalls nicht, dass ich wüsste -, aber genauso stelle ich mir den Geschmack vor. Bitter, eine Spur zu salzig und schal obendrein. Auch die Farbe dürfte hinkommen. Bier ist das auf keinen Fall. Nicht einmal eines, das seit Monaten abgestanden ist, könnte so widerlich schmecken.
Trotzdem setze ich den Krug abermals an die Lippen und nehme einen kräftigen Zug. Es befeuchtet meine Kehle, die nach der letzten Rauferei unter der prallen Sonne ausgedörrt ist. Und irgendwo unter dem schalen und aufdringlichen Geschmack spüre ich das leichte Kribbeln von Alkohol, das sich beruhigend auf meine angekratzten Nerven legt und den nahezu ohrenbetäubenden Geräuschpegel dämpft, der um mich herum in der viel zu kleinen Wirtsstube wütet.
Für ein besseres Getränk oder gar eine warme Mahlzeit fehlt mir das nötige Kleingeld. Selbst mit der Miete für das winzige Zimmer im ersten Stock des Gasthauses, in dem ich mich kaum um die eigene Achse drehen kann, bin ich im Rückstand.
Seufzend stelle ich den Krug beiseite und verschränke die Arme auf dem runden Tisch mit der klebrigen Holzplatte. Auf Reinlichkeit legt hier niemand Wert; ich will mir lieber nicht vorstellen, wovon die Klebrigkeit stammt, die an der blanken Haut meiner Unterarme ziept. Allein von verschüttetem Pferdepisse-Bier bestimmt nicht.
Seufzend stoße ich den Atem aus. Ich hätte es besser wissen sollen, anstatt Hals über Kopf alles hinter mir zu lassen, was ich kannte. Es hätte mir klar sein müssen, dass meine wenigen Ersparnisse nicht ewig reichen. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass wegen eines Fehlers alles den Bach runtergehen könnte. Schlimm genug, dass ich die alleinige Schuld auf mich genommen habe und deshalb unehrenhaft aus den Diensten meines Lehnsherrn entlassen wurde.
Doch viel furchtbarer als diese Schmach und die damit einhergehende unsichere Zukunft war der Moment, als ich allein im Bett aufwachte. Die Seite neben mir war nicht bloß leer, sondern das Laken bereits kalt.
Und über die Hälfte meiner Ersparnisse war ebenfalls spurlos verschwunden.
Ohne Arbeit und ohne ihn hielt es mich keine Sekunde länger in der Burg, die seit über fünfzehn Jahren mein Zuhause war.
Auf meine tadellose Ausbildung lasse ich nichts kommen; ich zähle wohl zu den besten Schwertkämpfern Bellvors. Aber das interessiert andere Lehnsherren oder Heerführer herzlich wenig, wenn sie sehen, dass ich eine Frau bin.
Durch das Training mit Schwertern und Äxten habe ich mir muskulöse Oberarme erarbeitet. Hinzu kommt, dass ich gut einen halben Kopf größer als die meisten Frauen bin.
Leider habe ich keinen Einfluss auf meinen Körperbau. Ich wünschte, mein Kreuz wäre durch das Waffentraining genauso breit wie die meiner Knappenkameraden geworden und meine Hüften wären so schmal wie ihre geblieben. Doch das kann ich mit weiten Hemden und Hosen umspielen, die meine Silhouette ein wenig verschieben.
Ich könnte perfekt mit der Masse verschmelzen und alle glauben machen, ich sei ein etwas zierlicher Mann – wären da nicht mein zartes, leicht rundes Gesicht, die vollen Lippen, die etwas zu großen grünen Augen mit den langen, dunklen Wimpern und mein rostrotes Haar, das ich stets hochgesteckt trage.
Spätestens sobald mir jemand ins Gesicht sieht, weiß mein Gegenüber unweigerlich, dass er eine Frau vor sich hat, ganz gleich wie fleißig ich in der Vergangenheit trainiert habe und wie penibel ich darauf achte, keine enge Kleidung zu tragen, die meine Rundungen preisgibt.
Oft denke ich, dass sich meine Mutter im Grabe umdrehen würde, könnte sie mich sehen. Sie war eine sanfte, zierliche Frau. Das Sinnbild der holden Maid, immer mit einem gütigen Lächeln für jeden auf den Lippen. Wohingegen ich unter Knappen und später Rittern und Söldnern aufgewachsen bin und mir sowohl ihre Sprechweise als auch Verhaltensmuster angewöhnt habe.
Nein, meine Mutter würde ihr kleines Mädchen, das ungeduldig auf Vaters Schoß auf die nächste Geschichte gewartet hat, nie und nimmer mit der Frau in Einklang bringen können, zu der ich geworden bin.
Ich nehme einen weiteren tiefen Zug der undefinierbaren Flüssigkeit aus meinem Krug, während ich das Geschehen in der Kaschemme beobachte. Ein Neuankömmling ist gerade eingetreten, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Scheinbar wahllos spricht er die hiesigen Anwesenden an, doch alle weisen ihn ab. Ich wüsste zu gern, worum es geht, kann es aber auf die Entfernung nicht verstehen. Obwohl der Ankömmling einen langen Umhang trägt, zeichnet sich darunter ein kräftiges Kreuz ab.
»He.«
Der Gestank eines seit wer weiß wie lange ungewaschenen Leibes brennt in meiner Nase, als sich ein Mann ungefragt an meinen Tisch gesellt. Ich werde nicht viel besser riechen, denn ein Bad stand die letzten Wochen auf meiner Prioritätenliste weit unterhalb einer Mahlzeit und einem Dach über dem Kopf.
Ich mache mir nicht die Mühe aufzublicken, sondern starre stur in die Plörre in meinem Becher. Das bringt mir einen Stoß gegen den Oberarm ein.
»Der Wirt sagt, du schuldest ihm Geld«, brummt der Mann.
Das ist nicht gelogen. Ich bin jedoch davon ausgegangen, auf noch ein wenig Nachsicht hoffen zu können. Oder davon, dass es nicht so schwer sein kann, eine neue Arbeit zu finden. Hier, in der Nähe der Grenze nach Lerthau, machen neben allerlei Gesindel auch einige Gutbetuchte halt. Ich bot an, mein Können mit dem Schwert im Kampf gegen ihre aktuellen Leibwächter zu demonstrieren, und ich gewann all diese Kämpfe. Trotzdem nahm mich niemand in seine Dienste. Eine Frau, sagten sie, brächte in einer eingeschworenen Männereinheit nur Ärger.
Etwas Ähnliches hat mein Lehnsherr zu mir gesagt, als er von meiner Beziehung erfuhr. Und während er mir die Striemen an meinem Rücken zufügte, wiederholte er diese Aussage.
Das Schlimme ist, dass ich ihm in diesem Moment zustimmte.
Vielleicht war das mein Fehler. Vielleicht war das der Grund, warum ich die Götter erzürnt habe. Denn eine Beziehung zwischen Schicksalsgebundenen bringt niemals Ärger, sondern ist eine von den Göttern vorhergesehene Verbindung, die in Ehren gehalten werden muss.
Aber als die Reitgerte des Lehnsherrn auf mich niederging, verfluchte ich nicht bloß stumm ihn, die Gerte und meine Dummheit, die mich in diese Situation gebracht hatte, sondern auch die Wahl der Götter für mich.
Wieder stößt mich der Mann gegen meinen Oberarm, fester diesmal. »He, bist du taub? Ich rede mit dir!«
In den knapp zwei Wochen, die ich bereits hier bin, habe ich mehrmals erlebt, wie der Mann im Namen des Wirts Schulden eingetrieben hat und dabei nicht zimperlich vorgegangen ist.
Mit einem Zähneknirschen krame ich in meiner Börse, die ich fest am Gürtel trage. Vorhin habe ich ein paar Kupfermünzen bei einem Armdrückwettbewerb gegen einige Betrunkene gewonnen. Die waren eigentlich gedacht, um mir das Essen der nächsten zwei Tage zu sichern, doch nun lege ich die Hälfte davon widerwillig auf den klebrigen Tisch.
»Hier«, brumme ich.
»Das reicht nicht«, entgegnet der Mann sofort.
Ich stelle den Krug beiseite und schaue zu ihm auf. Sein Gesicht ist vom zu vielen Alkoholgenuss gezeichnet, seine Haut durchzogen von auffällig roten Äderchen. Finster erwidert er meinen Blick, doch ich wende meinen nicht ab.
»Das muss reichen«, beharre ich.
»Tut es aber nicht!«, schnappt er. Als er sich zu mir herabbeugt, weiche ich auf meinem Stuhl so weit wie möglich zurück. »Ich könnte ein Auge zudrücken. Einige andere und ich würden uns über ein wenig nette Gesellschaft freuen. Wenn du weißt, was ich meine.«
Ja, ich verstehe durchaus, was er meint. Abrupt springe ich von meinem Stuhl auf, sodass er nach hinten umfällt. »Vergiss es! Ich werde meine Schulden begleichen. Der Wirt hat darauf mein Wort, aber –«
Grob umfasst er meinen Arm. »Dein Wort zählt hier nicht, Weibsbild. Wenn du deine Schulden nicht abarbeiten willst, musst du –«
»Verzeihung.«
Mein Kopf ruckt zu der Stimme herum. Ein weiterer Mann ist zu uns getreten. Es ist der Neuankömmling, der mir in der Nähe der Tür aufgefallen ist. Mittlerweile hat er seinen Umhang abgenommen. Sein dunkelblondes Haar ist kurz geschnitten. Kritisch mustert er den Mann, der mich immer noch gepackt hat, aus Augen, deren Farbe eine wilde Mischung aus Kupfer und Gold ist. Anhand seines breiten Rückens, für den ich meine Seele jedem mir bekannten Gott verkauft hätte, halte ich ihn für einen ausgebildeten Ritter. Dafür ist aber seine Kleidung zu fein und zu verziert; ein Ritter oder auch Söldner, der jederzeit in Kämpfe verwickelt werden kann, würde niemals auf mit goldenen Stickereien gesäumte Tuniken zurückgreifen. Aber Kampferfahrung hat er in jedem Fall, wie mir die Muskeln seiner Oberarme beweisen, die sich deutlich unter dem hauchzarten Stoff seiner Tunika abzeichnen.
»Was willst du?«, keift der Mann.
Für einen winzigen Moment zuckt der Neuankömmling unter der barschen Stimme zusammen. Verwundert runzele ich darüber die Stirn.
»Die Dame hat gesagt, dass sie den Rest der Schulden begleichen wird«, teilt er dem Mann mit.
»Halt dich da raus, Bürschchen!«, giftet der Mann.
Der Neuankömmling strafft die breiten Schultern. »Mein Herr, ich muss insistieren.«
Ich verdrehe seufzend die Augen, während der Mann über die gehobene Wortwahl des Neuankömmlings in schallendes Gelächter ausbricht.
Ehe die beiden aneinandergeraten, sage ich: »Ich werde den Rest spätestens morgen begleichen.«
Der Blick des Mannes fliegt zu mir zurück. »Das hast du dem Wirt letzte Woche schon versprochen!«
Auch das ist nicht gelogen. Da ging ich jedoch davon aus, dass ich schnell neue Arbeit finde oder ein Gerücht über den Aufenthaltsort meines Schicksalsgebundenen aufschnappe.
Beide Hoffnungen sind jedoch in zu viel Pferdepisse-Bier ertrunken.
Ich gebe es ungern zu, aber mit jedem Tag und jeder Zurückweisung strengte ich mich weniger an, um etwas an meiner Situation zu ändern.
Ich straffe die Schultern. »Ich werde Arbeit oder zumindest einen Auftrag finden und damit als Erstes meine Ausstände begleichen.«
Der Mann gibt ein verächtliches Schnauben von sich. »Für Schmarotzer wie dich haben wir hier keinen Platz!«
Er stößt mich zurück. Normalerweise würde mir das nichts ausmachen und mittels eines Schrittes hätte ich mein Gleichgewicht wiedergefunden. Doch nun trete ich auf den umgestürzten Stuhl, versuche noch, mich an der Tischkante festzuhalten, aber auch der Tisch gibt nach. Ich gehe mit Krach und Getöse zu Boden, und zu allem Überfluss ergießt sich der Rest des Pferdepisse-Biers über meinem Schoß. Sogleich erschallt lautes Gelächter aus allen Ecken des Gastraums. Meine Wangen brennen wie Feuer, als ich mich krampfhaft darum bemühe, wieder hochzukommen, was angesichts meiner Füße, von denen sich einer in den Stuhlbeinen verfangen ha, während der andere noch unter der Tischplatte steckt, alles andere als leicht ist.
Viel härter trifft mich allerdings das Gelächter, das einfach nicht verstummen will.
Irgendwie schaffe ich es auf die Füße und wische mir fahrig über mein besudeltes Hemd und die Hose. Der Gestank des Gesöffs steigt mir in die Nase. Ich spüre förmlich, wie mir die Kontrolle entgleitet, und ich lasse sie ziehen, dankbar dafür, ein Ventil für meine angestaute Frustration der letzten Wochen gefunden zu haben.
»Ist alles in Ordnung?«
Ich schiebe den Neuankömmling grob zur Seite, der mir gerade aufhelfen wollte, marschiere auf den Mann zu und hole mit der Faust aus. Das Geräusch, als meine Faust Bekanntschaft mit seinem Kieferknochen macht, übertönt endlich das Gelächter um mich herum und besänftigt das laute Brüllen nach Vergeltung in mir.
Der Mann taumelt, tut mir aber nicht den Gefallen, zu Boden zu gehen. Ich stoße genervt ein Grollen deswegen aus.
»Ich sagte«, brumme ich, »ich bezahle den Rest morgen.«
Der Mann wischt sich mit dem Handrücken über den Mund und spuckt daraufhin Blut auf den Boden. Sofort wird mir flau im Magen; hastig wende ich den Blick von dem Blutspritzer ab und atme vorsorglich nicht mehr durch die Nase. Zwar werde ich das Blut angesichts all der unzähligen anderen Gerüche nicht herausriechen können, doch ich gehe lieber kein Risiko ein.
Um uns herum erheben sich weitere Gäste von ihren Tischen. Sie alle gehören zu jenen, die bereits länger hier sind – genau solch Glücklose wie ich. Mit ihnen könnte ich fertigwerden, auch wenn meine Sinne durch das billige Bier leicht benebelt sind.
Gerade als ich mich für einen drohenden Angriff bereitmachen will, stellt sich der Neuankömmling vor mich.
»Ich bin mir sicher, dass wir das friedlich –«
Weiter kommt er nicht, denn der erste Gast geht brüllend auf ihn los. Ich reiße ihn an der Schulter zurück, wirbele herum und ramme dem Angreifer meine Faust in die Magengrube. Er sackt nach Luft schnappend in die Knie.
Ich nutze die kurze Atempause, um den Neuankömmling anzuschreien. »Bist du wahnsinnig? Wenn du dich in einen Kampf einmischst, dann nutze deine großen Hände sinnbringend und verteile ein paar Ohrfeigen!«
»Aber …«
Dem nächsten Angreifer schleudere ich meinen umgestürzten Stuhl entgegen und halte ihn dadurch auf Abstand.
»Was ›Aber‹?«, will ich wissen.
Unsicherheit huscht durch die honigbraunen Augen des Mannes. »Ich musste noch nie … Ohrfeigen verteilen.«
Ich seufze. »Das ist jetzt nicht wahr, oder?«
Insgeheim habe ich gehofft, dass er mir ein wenig zur Seite steht, und sei es nur, weil er der Meinung ist, er müsste seine ritterlichen Ansichten an mir – der armen Maid in Nöten – ausleben. Dass ich meine Kämpfe sehr gut allein ausfechten kann, weiß er schließlich nicht.
Als ein weiterer Angriff erfolgt – diesmal von zwei Männern -, schlingt der Neuankömmling beide Arme um seinen Kopf, um sich zu schützen. Hätte ich vorhin den Tisch nicht umgeworfen, würde er sich vermutlich darunter verkriechen.
Ich gebe einen genervt klingenden Laut von mir. Offenbar bin ich diejenige, die nun ihre ritterlichen Tugenden entdeckt, denn ich gebe darauf acht, dass die Angreifer nicht an ihn herankommen.
Während ich packenden Händen ausweiche und ein paar Fausthiebe verteile, die leider nicht alle die gewünschte Wirkung erzielen, werfe ich stets einen Blick über die Schulter, um sicherzugehen, dass sich keiner an dem Neuankömmling vergreift.
Nie wäre ich bei seiner kräftigen Statur davon ausgegangen, dass er sich vor einem Kampf fürchtet. Doch nun kauert er schier am Boden und kneift die Augen zu, wann immer die Fäuste fliegen oder etwas zu Bruch geht.
Und es geht eine Menge zu Bruch.
Mehr Gäste mischen sich in den Kampf ein, sobald ein Angreifer dummerweise auf ihrem Tisch landet und ihr schales Bier verschüttet. Es dauert nicht lange, bis ich nahezu die gesamte Wirtsstube gegen mich habe und die halbe Einrichtung demoliert ist.
Bei so vielen Gegnern, die aus unterschiedlichen Richtungen angreifen, lässt mich irgendwann mein Glück im Stich. Bisher konnte ich mich gegen die Männer behaupten, weil die meisten von ihnen bereits am helllichten Tag mehr Pferdepisse-Bier zugesprochen hatten als ich. Doch gegen diese Übermacht, die sich mir nun geballt in den Weg stellt, bin auch ich machtlos.
»Zurück«, raune ich dem Neuankömmling zu. »Nutze die erste Gelegenheit zu verschwinden, sobald sie sich dir bietet.«
»Aber ich kann doch nicht …«
Die Männer schieben die umgestürzten Tische und Stühle beiseite und stapfen auf mich zu. Ich tippe richtig darauf, dass es der rechte ist, der mich zuerst angreifen wird, sehe dabei die Attacke des linken nicht rechtzeitig kommen. Ein Schlag in den Nacken lässt mich für einen Moment Sterne sehen. Zeit genug, dass zwei weitere Männer mich packen und auf die Knie zwingen können. Zwar wehre ich mich nach Leibeskräften, kann mich jedoch nicht befreien.
»Lasst mich los, verdammt!«, grolle ich, während ich mich wieder und wieder aufbäume.
Der erste Mann, der die Schulden für den Wirt eintreiben wollte und als Rädelsführer der Männer fungiert, bringt mich mit einem Fausthieb in die Magengrube zum Schweigen. Verzweifelt japse ich nach Luft. Sein Schlag war vergleichsweise schwach; ich musste in der Vergangenheit weit härtere einstecken. Dennoch verfehlt er seine Wirkung nicht.
»Du hättest nur brav bezahlen müssen«, raunt der Mann, als er sich zu mir herabbeugt. »Durchsucht sie!«
Ich ziehe scharf die Luft ein, als die ersten fremden Hände über mich wandern, während andere mich noch immer unten halten. »Nehmt eure verfluchten –!«
»Aufhören!« Der Neuankömmling erhebt sich zu voller Größe, in der er den Rädelsführer um gut eine Kopfeslänge überragt.
»Was mischst du dich denn schon wieder ein?«, knurrt der Mann, nachdem er seine Stimme wiedergefunden hat. »Willst du auch meine Faust zu spüren kriegen?«
Daraufhin nestelt der Neuankömmling an der Börse an seinem Gürtel und wirft sie dem Mann vor die Füße. Angesichts des lauten Klimperns, das im mucksmäuschenstillen Raum widerhallt, muss sie prall gefüllt sein.
»Ich bezahle für ihre Ausstände«, sagt der Neuankömmling, »und für …«, er breitet die Arme aus, »… den angerichteten Schaden.«
Die suchenden Hände halten inne, der Kopf des Rädelsführers ruckt nach oben.
Ich drehe den eigenen so weit zu ihm um, wie es mir in meiner gefangenen Position möglich ist. Wut und Scham kämpfen gleichermaßen in mir. Wut darüber, dass er sich einfach einmischt und meint, mir aus der Patsche helfen zu müssen. Scham darüber, dass ich erst in diese Lage geraten bin. Das wäre mir vor ein paar Monaten nicht passiert. Zwar war ich nie für Ruhe und Ausgeglichenheit bekannt, aber ich hätte nicht wegen ein paar Kupfermünzen eine handfeste Schlägerei vom Zaun gebrochen – und sie verloren.
Letztendlich gewinnt mein Stolz die Oberhand. »Was soll das?«, zische ich den Neuankömmling an. »Ich habe alles unter Kontrolle!«
Er wirft mir einen Seitenblick zu und zieht eine Augenbraue hoch. »Ja. Das ist nicht zu übersehen.«
Sein ironischer Tonfall, zusammen mit der provokant hochgezogenen Augenbraue trifft einen Nerv bei mir. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich in der Vergangenheit auf eine ähnliche Weise angeschaut wurde: herablassend, zweifelnd, als sei ich unwürdig. Allen, die es gewagt haben, mich derart anzuschauen, habe ich bewiesen, dass ich besser bin als sie. Dass ich allen Widrigkeiten trotzen und wieder aufstehen kann.
Auch jetzt versuche ich, auf die Füße zu gelangen, scheitere jedoch. Es gibt wenig, was ich mehr hasse, als vor einem Gegner zu knien. Mir ist natürlich klar, dass es nicht gut für mich ausgehen würde, selbst wenn es mir gelänge, hochzukommen. Nie könnte ich gegen alle Gegner bestehen.
Doch alles in mir sträubt sich dagegen, hier zu knien und Almosen von einem völlig Fremden anzunehmen.
Nachdem der Rädelsführer die Geldbörse aufgehoben und sie in seiner Hand gewogen hat, gibt er ein zustimmendes Brummen von sich. »Das scheint mir ein gutes Angebot zu sein. Nur eins fehlt noch.«
Er macht einen Schritt auf mich zu. Ehe ich den Mund öffnen kann, rammt er mir seine Faust gegen die Wange. Mein Kopf wird zur Seite geschleudert. Sofort schmecke ich Blut und Panik kriecht in mir hoch. Ich bin machtlos gegen die Übelkeit, die in mir aufsteigt, sich in meinem Mund sammelt und sich in dem Moment einen Weg nach draußen bahnt, als die Männer mich loslassen. Würgend und keuchend erbreche ich mich auf die Holzdielen.
»Jetzt sind wir quitt«, lässt mich der Rädelsführer wissen, dessen Stimme von ganz weit weg zu kommen scheint.
Ich würge weiter und speie das billige Bier heraus. Selbst dieser saure, widerliche Geschmack ist tausendmal besser als der des Blutes in meinem Mund.
Meine Augen tränen, deshalb erkenne ich die Gestalt, die plötzlich vor mir hockt, nur undeutlich. Ich zucke zurück und hebe schützend einen Arm vor mein Gesicht. Ist es noch nicht vorbei? Hat einer der Männer doch beschlossen, dass meine Schuld noch nicht beglichen ist?
»Ich tue Euch nichts«, sagt der Neuankömmling, als er einen Finger unter mein Kinn legt und mich mit sanftem Druck dazu bringt, den Kopf zu heben. »Ich will mir bloß Eure Verletzungen ansehen. Nicht, dass etwas gebrochen ist.«
Routiniert betastet er meine Wange, meinen Kiefer und nimmt schließlich meine Hände in seine. Er brummelt etwas Unverständliches über die aufgeschürften Knöchel, ehe er geschäftig die einzelnen Fingerknochen abtastet.
Ich runzele die Stirn und vertreibe blinzelnd die letzten Tränen, die mir noch in den Augen brennen. »Wer bist du?«
Meine Stimme klingt vom Würgen ganz rau, trotzdem versteht er mich.
»Mein Name ist Garreth und ich würde Euch gern als meine Leibwächterin anheuern.«
Kapitel 2
Delmira
Noch immer beherrscht der Blutgeschmack meinen Mund und lässt mich abermals würgen. Irgendwie gelingt es mir, mich von Garreth abzuwenden und ihm nicht direkt auf den Schoß zu kotzen. Das Pferdepisse-Bier schmeckt auch beim nunmehr zweiten Mal, dass es meinen Mund flutet, nicht besser, sondern noch bitterer und sauerer. Aber wenigstens vertreibt es endlich den Blutgeschmack. Ohne ihn gelange ich wieder halbwegs zur Besinnung. Vorsichtig fahre ich mit der Zunge meine Zähne entlang. Zum Glück habe ich keinen eingebüßt.
»Wartet«, sagt Garreth. »Ich habe etwas gegen Eure Schmerzen.«
Mit verwirrt gerunzelter Stirn beobachte ich, wie er in der Gürteltasche an seiner Hüfte wühlt. Nach einigen Augenblicken fördert er eine kleine, etwa zeigefingergroße Phiole mit einer grünen Flüssigkeit zutage, entkorkt sie und hält sie mir hin.
Als ich sie nicht sofort ergreife, erklärt er: »Das ist eine Mischung aus Kupferblatt und Uferblume. Es wird Eure Schmerzen lindern und die Blutung in Eurem Mund stillen.«
Noch immer bewege ich mich nicht und starre ihn nur an. Warum sollte ich die Phiole auch ergreifen? Von den Zutaten, die angeblich in der Flüssigkeit sein sollen, habe ich nie zuvor etwas gehört.
Als ich nicht die Hand nach der Phiole ausstrecke, hält Garreth sie mir an die Lippen und kippt den Inhalt in meinen Mund. Es ist bloß ein winziger Schluck, der mir direkt die Kehle hinabfließt, ehe ich protestieren kann.
»Gleich wird es Euch etwas besser gehen«, verspricht er.
Ich ziehe die Augenbrauen zusammen, während ich versuche, den Geschmack auf meiner Zunge zu identifizieren, der sich nun mit dem sauren des Erbrochenen vermischt. »Woher willst du das wissen?«
»Ich stamme aus einer Familie von Kräuterkundigen«, antwortet er. »Sagt Euch der Name Eslinger irgendetwas?«
Eslinger. Irgendetwas klingelt bei diesem Namen bei mir. Es dauert nur einen Moment, bis es mir einfällt.
»Sind die Eslingers nicht die persönlichen Heiler des Königs von Bellvor?«, frage ich.
Garreth nickt. »Meine Familie steht schon seit vielen Generationen in den Diensten des Herrschers unseres Landes. Früher gab es in unseren Reihen fähige Magier, aber …«
Er zuckt mit den Schultern, und ich verstehe, was er meint. Magie ist heutzutage nichts weiter als eine Legende. Es muss mehrere Jahrhunderte her sein, seit es Menschen in den vier Reichen gab, die Magie wirken konnten – Hexen ausgenommen. Diese magisch bewanderten Frauen, die die direkten Nachkommen der Götter sind, gibt es noch heute.
Und jeder, der weiß, was gut für ihn ist, macht einen großen Bogen um sie.
Es heißt, die Götter waren müde, uns Menschen dabei zuzusehen, wie wir unsere von ihnen geschenkte Magie bloß dazu nutzten, um uns gegenseitig das Leben schwerzumachen. Also nahmen sie uns dieses Geschenk wieder weg und reichten es an ihre Kinder weiter.
Als es noch Magie gab, kann ich mir vorstellen, dass die Herrscher der Reiche sich mit Zauberkundigen umgaben. Gerade der Familie Eslinger wird nachgesagt, dass die Heiler in ihren Reihen besonders mächtig waren. Heute sind sie nichts weiter als einfache Menschen, die über ein weitreichendes Wissen über Pflanzen und Kräuter verfügen.
Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, einem aus dieser Linie zu begegnen. Normalerweise dienen die Eslingers nur äußerst zahlungskräftigen Kunden, wie der Königsfamilie, und begeben sich so gut wie nie aus deren Wirkungskreis.
Ich runzele die Stirn, während ich Garreth mit all diesen Informationen in neuem Licht betrachte.
»Du siehst nicht aus wie ein Eslinger«, sage ich schließlich.
Er verzieht den Mund und wirkt, als hätte ich einen wunden Punkt erwischt. »Wie sieht denn ein Eslinger Eurer Meinung nach aus?«
»Wie ein Gelehrter«, antworte ich. »Jemand, der den ganzen Tag über seine Nase in Bücher steckt und irgendwelche Tinkturen zusammenrührt, erlangt nicht solche Muskeln wie du.«
Mit einer fahrigen Handbewegung deute ich auf sein breites Kreuz und die kräftigen Oberarme. Ausgeschlossen, dass die daher stammen, dass er einige Bücherstapel durch die Bibliothek getragen hat.
»Ihr stellt Euch die Arbeit als Heiler viel zu leicht vor«, sagt er in tadelndem Tonfall. Der missbilligende Ausdruck um seinen Mund ist verschwunden. »Die Arbeit im Kräutergarten. Das Schneiden von Misteln in hohen Bäumen, auf die ich zunächst klettern muss. Das Tragen von Säcken voll Erde und Dünger.« Er zuckt mit den Schultern. »Früher mögen die Heiler so ausgesehen haben, wie Ihr sie Euch vorstellt, weil sie mit Magie alle Probleme lösen konnten. Aber wir müssen heutzutage für jede Salbe und jede Tinktur hart arbeiten. Das geht nicht spurlos an uns vorbei.«
Eine Weile betrachte ich ihn musternd. »Wenn du meinst.«
Er nickt. »Wenn ich nun auf mein Angebot zurückkommen dürfte …«
Ich verdrehe die Augen. Inständig habe ich gehofft, dass er vergessen hat, mich als Leibwächterin anheuern zu wollen.
»Ich muss dich enttäuschen, Garreth Eslinger«, sage ich. »Ich bin als Leibwächterin nicht sonderlich gut geeignet. Aus meiner letzten Anstellung wurde ich entlassen, weil ich nachlässig war. Jetzt habe ich nicht mehr als die schmutzige Kleidung, die ich am Leib trage, und das Schwert in meinem Zimmer. Sofern diese Mistkerle es mir nicht gestohlen haben, um meine Schulden zu begleichen.«
Heilige Götter, hoffentlich haben sie das nicht! Das Schwert ist ein Geschenk meines Lehnsherrn zum erfolgreichen Abschluss meiner Ausbildung und mein kostbarster Besitz. Selbst wenn mein Leben davon abhinge, würde ich es nicht versetzen.
Wenn ich mir vorstelle, dass einer dieser schmierigen Widerlinge seine dreckigen Finger an mein Schwert gelegt hat, dann …
Garreths Augen werden eine Spur dunkler. »Vergesst Ihr nicht etwas Entscheidendes?«
»Und was soll das sein?«
Er zieht eine Augenbraue nach oben. »Ich habe Eure Schulden beglichen. Ich habe dafür gesorgt, dass diese Männer Euch nicht … wer weiß was antun.« Seine Wangen verfärben sich auf eine irgendwie niedliche Art rot.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Ich habe dich nicht darum gebeten«, erwidere ich.
»Aber Ihr schuldet mir etwas.«
Ich stoße geräuschvoll den Atem aus und kaue anschließend auf meiner Unterlippe. Ich gebe es ungern zu, doch ohne seine Hilfe hätten mich diese Kerle zu Brei geschlagen und mich anschließend auf die Straße geworfen. Gut möglich, dass ich die kommende kalte Nacht nicht überlebt hätte. Oder die darauffolgenden Wochen, denn ohne eine Münze hätte ich nirgendwo sonst Unterschlupf oder etwas zu essen erhalten.
Wie ich es auch drehe und wende: Ich schulde ihm etwas. Außerdem sollte ich ihm dankbar sein, dass er mir einen Auftrag angeboten hat. Seit ich hier an der Grenze angekommen bin, versuche ich händeringend jemanden zu finden, der meine Dienste benötigt. Warum sträube ich mich also so sehr dagegen?
Während meiner Knappenausbildung habe ich mir die Fähigkeit angeeignet, mein Gegenüber einzuschätzen. Garreth gehört zu jenem Schlag Menschen, die das Unglück magisch anziehen. Menschen, die zu leichtgläubig sind und in allem und jedem nur das Gute sehen. Menschen, die deswegen ständig in Schwierigkeiten geraten.
Schwierigkeiten, die ich als seine Leibwächterin ausbügeln müsste.
Doch das ist nicht der einzige Grund, warum ich hier nicht weg will.
Ehe ich zu einer weiteren Erwiderung ansetzen kann, fragt er: »Was habt Ihr zu verlieren?« Er breitet die Arme aus. »Hängt Ihr etwa an diesem heruntergekommenen Gasthaus?«
»Nein«, gebe ich zu. »Es ist bloß … Ich dachte, ich würde hier, in der Nähe der Grenze nach Lerthau, ein paar … Informationen über jemanden finden. Die letzten haben mich hierhergeführt.«
»Wenn Ihr meinen Auftrag abgeschlossen habt, könnt Ihr meinetwegen wieder hierherkommen und eine Weile bleiben. Denn die Bezahlung, die Ihr erhaltet, wird Euch eine Unterkunft in diesem miesen Rattenloch für eine ganze Weile ermöglichen.«
Beim Wort »Bezahlung« spitze ich unweigerlich die Ohren. Bis eben dachte ich, ich müsste seinen Auftrag aus purer Dankbarkeit erfüllen; immerhin hat er eine große Summe bezahlt, um mich freizukaufen. Nun zu hören, dass ich darüber hinaus eine weitere Bezahlung erhalte, lässt mich beinahe zustimmen, bevor ich die Details kenne. Mit genügend Geld könnte ich weiter nach ihm suchen.
Batur, meinen Schicksalsgebundenen.
Wenn es mir nicht gelingt, könnte mich der Zorn der Götter treffen, und dann ist alles aus. Nachdem ich die letzten Wochen auf der Stelle getreten bin – um nicht zu sagen, dass ich in einem dunklen Loch saß, aus dem ich keinen Ausweg fand -, könnte ich nun einen Schritt vorwärts machen. Ich war bereits in der Vergangenheit eine Leibwächterin und habe meine Sache gut gemacht.
Mit einer einzigen Ausnahme.
Diese wird sich aber nicht wiederholen, schließlich ist er wie vom Erdboden verschluckt.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. »Ich müsste lediglich auf dich aufpassen? Wie lange? Und auf welche Feinde müsste ich mich einstellen?«
»Ich bin auf dem Weg nach Lerthau«, sagt er, und seine Augen leuchten wieder wie frisch erwärmter Honig. »Dort gibt es einen See, an dem sich ein Artefakt der Götter befindet. Ein Schwert, das in einem Stein steckt, und …«
Ich seufze verstohlen. Zwar redet Garreth noch eine Weile weiter, aber ich weiß auch so, von welchem Schwert er redet. Schließlich gibt es nur ein Schwert, das einst dem Namenlosen Prinzen gehörte und nun für alle Zeit versiegelt in einem Stein steckt. Und mit diesem Schwert will ich nichts zu tun haben. Heute weiß ich, dass ein Schwert und das Können, damit umzugehen, einem zwar viele Türen öffnet, einen jedoch nicht zu großen Taten beflügelt.
»… und wenn wir erst einmal dort sind, könntest du versuchen, es aus dem Stein zu ziehen«, beendet Garreth seine Ansprache.
»Vergiss es.«
Seine Augenbrauen schießen ungläubig in die Höhe. »Aber –«
Ich schneide ihm das Wort ab. »Seit keine Ahnung wie vielen Jahren steckt dieses Schwert im Stein, und niemand war bisher in der Lage, es herauszuziehen. Wie kommst du auf die Idee, dass es ausgerechnet mir gelingt?«
Dass ich mit dem verdammten Schwert rein gar nichts zu tun haben will, weil es sinnbildlich für alles steht, was ich verloren habe, verschweige ich. Das geht ihn nichts an. Ich habe niemandem davon erzählt, nicht einmal Batur. Nachdem mein Lehnsherr mich gerettet hat, habe ich mein Bestes getan, um meine Vergangenheit zu vergessen – die guten sowie die schlechten Zeiten und alles, was damit zu tun hat.
Einschließlich Geschichten für kleine Mädchen über wagemutige Prinzen und magische Schwerter.
Ich musste früh lernen, dass Geschichten weder satt machen noch ein Dach über dem Kopf bieten.
Garreth hebt die Schultern. »Mir ist es im Grunde egal, wem es gelingt, es herauszuziehen. Ich brauche dieses Schwert.«
»Hast du es denn schon selbst versucht?«
Er nickt. »Nicht bloß ein Mal.«
»Und warum kommst du jetzt zu mir?«
»Ich war zuvor bereits bei einigen anderen Söldnern«, sagt er. »Sie alle haben es nicht geschafft, aber ich werde nicht aufgeben. Ich habe seit Jahren all mein Gold gespart und werde denjenigen, dem es gelingt, fürstlich belohnen. Ich zahle jede Summe, wenn ich nur das Schwert erhalte.«
Jede Summe.
Ich schlucke bei diesen beiden Worten angestrengt. Allein die Vorstellung, nie wieder hungrig oder stinkend und vor Schmutz starrend einschlafen zu müssen, macht seinen Auftrag verführerisch. Nicht dass ich mir Chancen ausmale, das Schwert tatsächlich herausziehen zu können. Bloß für einen Moment schleicht sich dieser Gedanke zusammen mit dem »Und dann?« in meinen Kopf. Es gibt Menschen, in deren Hände ein magisches Schwert niemals gelangen sollte. Ich schätze Garreth zwar nicht so ein, dass er mit Caligrams Hilfe die Weltherrschaft an sich reißen will, dennoch hinterfrage ich seine Motive. »Wieso willst du das verdammte Schwert so dringend haben?«
Seine Miene wirkt mit einem Mal abweisend. »Meine Beweggründe sollten Euch egal sein, da Ihr sowieso nicht vorhabt, mir zu helfen. Und falls Ihr mir doch helft, müsst Ihr sie ebenfalls nicht erfahren.«
Ich verdrehe die Augen und wende mich ab. »Könntest du bitte damit aufhören, derart förmlich mit mir zu reden? Das nervt.«
»Verzeih«, murmelt er hinter mir. »Ich war lange Zeit für die Behandlung der zahlreichen Töchter des Königs beauftragt. Deshalb spreche ich vermutlich jede Frau respektvoll an. Also …« Abwartend wippt er auf den Füßen. »Wie sieht es aus? Können wir dann los? Oder hast du einen besseren Auftrag, den du annehmen willst?«
»Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen, bloß weil du mich anheuern willst.«
Mit geschürzten Lippen betrachtet Garreth das Chaos, das die kleine Prügelei im Gastraum angerichtet hat. Nur am Tresen sitzen noch ein paar trinkfeste Gestalten; die anderen haben sich offenbar nach draußen oder in ihre Kammern verzogen, sodass Garreth und ich fast unter uns sind. »Ich verstehe natürlich, dass du diesem charmanten Wirtshaus nicht einfach so den Rücken kehren kannst.«
Ich recke das Kinn und übergehe seinen Spott. »Ganz genau. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Dein sinnloser Auftrag hält mich bloß auf.«
Zu meiner Verwunderung gibt er eine gemurmelte Zustimmung von sich. »Du bist auf der Suche nach einem Kerl, nicht wahr? Was ist passiert? Hat er dich sitzen lassen oder du ihn?«
Ich zucke angesichts der Tatsache, dass er mich so schnell durchschaut hat, obwohl wir gefühlt kaum mehr als fünf Sätze miteinander gewechselt haben, zusammen.
»Er ist nicht einfach nur irgendein Kerl«, gebe ich zurück. »Er ist mein Schicksalsgebundener.«
»Ah, deswegen also.« Seine Miene wirkt weich. »Ich habe mich schon gefragt, warum du hierbleibst. Du kamst mir bisher nicht so vor, als würdest du wegen eines dahergelaufenen Kerls dein Leben wegwerfen. Jetzt verstehe ich dich besser. Du kannst nicht gehen.«
Ich schlucke angestrengt. Mein Leben lang hielt ich mich für undurchschaubar dank der Mauer, die ich hochziehe, sobald ich mich mit jemandem verkehren muss, den ich nicht kenne. Ich gebe für gewöhnlich nichts von mir preis, und meistens verlieren die Leute schnell das Interesse an mir. Das ist ein großer Vorteil: Als Leibwächterin muss ich mit meiner Umgebung verschmelzen können und darf nur so wenig wie möglich auffallen. Jede Information über mich könnte meinem Gegner in die Hände spielen. Doch anhand der wenigen Fetzen, die ich über mich erzählt habe, hat Garreth sich ein ziemlich genaues Bild von mir gemacht. Ein wenig ängstigt mich das.
»Ich kann nicht zurück«, sage ich vage. »Nicht ehe ich ihn gefunden habe.«
»Weißt du, wo dein Schicksalsgebundener sich aufhält?«
Ich mustere Garreth kurz, um abzuwägen, wie viel ich ihm noch erzählen soll. Doch nach allem, was ich über ihn weiß, ist er kein Gegner. Was sollte er mit diesem Wissen anstellen? Er kann es nicht gegen mich verwenden, denn es gibt nichts mehr, was er oder ein anderer mir wegnehmen könnte.
Ich habe bereits alles verloren. Sogar meine Zukunft, der ich nun verbissen nachjage, um wenigstens sie zurückzuerlangen.
»Ich habe Gerüchte darüber gehört, dass er irgendwo in Lerthau sein soll«, sage ich. »Aber ich konnte es mir nicht leisten, die Grenze zu überqueren. Die verdammten spitzohrigen Soldaten an der Grenze haben mich lachend weggeschickt, als ich ihnen meine letzten Ersparnisse geben wollte. Deshalb habe ich in diesem Gasthaus, das der Grenze am Nächsten ist, haltgemacht, um meine Reisekasse aufzubessern.« Ich lasse die Hände in meine gähnend leeren Hosentaschen gleiten. »Leider ohne Erfolg. Und nun habe ich nichts mehr. Ja, ich könnte zu meinem Lehnsherrn zurück und vielleicht würde er mich wieder als seine Leibwächterin beschäftigen, wenn ich mich wegen meines Fehlers vor ihm in den Staub werfe. Was mein Stolz wahrscheinlich nicht zulassen würde. Aber selbst dann …«
»Dann hättest du ihn nicht zurück«, beendet Garreth meinen Satz für mich.
Ich bin erstaunt und verwirrt darüber, wie gut er mich versteht, obwohl wir uns kaum kennen und offenbar nichts gemeinsam haben. Und doch spüre ich seinerseits keinerlei Verurteilung über mein Handeln. Als ich meinem Lehnsherrn den Rücken kehren musste, hat er mich mit so vielen Verwünschungen versehen, dass ich sie unmöglich alle wiederholen kann. Ich wurde zwar aus dem Dienst als seine Leibwächterin entlassen, aber ich hätte in der Burg, in der ich seit meiner Kindheit lebte, sicherlich andere Arbeiten verrichten können. Er warf mich trotz meines Fehltritts nicht einfach auf die Straße, doch er konnte mich nicht weiterhin in seinen direkten Diensten belassen.
Der Großteil von mir hat Verständnis für sein Handeln. Der kleinere Teil, der ihn seit knapp fünfzehn Jahren als Vaterersatz angesehen hat, jedoch nicht. Wenden sich Eltern von ihren Kindern ab, wenn diese einen Fehler begangen haben? Oder ist es der Zorn der Götter, der mich traf, weil ich das höchste Gut, das sie uns zurückgelassen haben, mit Füßen getreten habe?
Auch die anderen Knappen und Ritter schüttelten nur mitleidig die Köpfe über meine Entscheidung zu gehen. Sie waren der Meinung, dass Batur schon früher oder später wieder auftauchen würde, wenn es der Wille der Götter sei, dass wir zusammen sein sollten. Ich war es jedoch leid, darauf zu warten, dass die Götter die Sache für mich regelten, und nahm die Suche nach meinem Schicksalsgebundenen selbst in die Hand. Auch wenn das bedeutete, alles, was ich kannte und besaß, hinter mir zu lassen. Ich spürte, dass ich einen riesengroßen Fehler begangen hatte, den nur ich allein wieder geradebiegen konnte. Danach würde sich alles finden, das wusste ich. Ich hätte jedoch nicht damit gerechnet, dass sich die Suche nach Batur derart schwierig gestalten würde …
Niemand verstand mich und meine Beweggründe. Warum sollte es also ausgerechnet dieser Heiler, der keine Ahnung von der Welt jenseits seiner Kräutertinkturen hat?
Garreth zieht sich einen Stuhl heran und setzt sich. »Ich tue ebenfalls alles dafür, meine Schicksalsgebundene für mich zu gewinnen.«
Ich werde hellhörig. »Und das versuchst du …«, mit einer fahrigen Handbewegung deute ich auf den demolierten Innenraum des Wirtshauses, »… hier?«
»Du standest zu deinem sechzehnten Geburtstag auch vor einer Priesterin, nicht wahr?«, fragt er.
Verwirrt über den Themenwechsel runzele ich die Stirn. »Natürlich.«
Es ist eine uralte Tradition, dass jeder Heranwachsende zu seinem sechzehnten Geburtstag oder kurz danach zu einem der Tempel der Götter gebracht wird, um die Weissagung der Götter aus dem Mund einer geweihten Priesterin zu hören. In den ländlichen Gebieten wie hier wird diese Tradition wahrscheinlich kaum gepflegt, aber mein Lehnsherr legte viel Wert darauf, dass wir alle unsere Weissagung erhielten und unser Leben danach richteten.
Hastig schiebe ich den Gedanken an meine beiseite. Zum Glück spricht Garreth weiter, ohne dass ich ihn darum bitten muss, und vertreibt meine Schwermut, bevor sie von mir Besitz ergreifen kann.
»Ich habe dir erzählt, dass ich für die medizinische Betreuung der Königstöchter Bellvors verantwortlich bin.«
Ich nicke. Der sogenannte König Bellvors ist nichts weiter als ein Nachkomme des Mannes, der sich vor Generationen zum Herrscher ausgerufen hat.
Umherziehende Ritter, die bei meinem Lehnsherren zu Gast waren, wussten zu berichten, dass es um die Gesundheit der königlichen Kinder – allesamt Mädchen – alles andere als gut bestellt ist. Ich habe mich nie darum geschert; sollte der aktuelle König ohne Nachkommen sterben, wird ein anderer sich zum Herrscher ernennen. Vielleicht wird es einige Kämpfe um Bellvors Thron geben, aber das soll mir nur recht sein – dann kommen Ritter wie ich leichter an Arbeit.
»Die Priesterin«, murmelt Garreth, »weissagte mir, dass ich mein Leben mit jemandem mit königlichem Blut teilen würde.«
Ich versteife mich angesichts der Tatsache, wie offen Garreth über seine Weissagung spricht. Das könnte ich nicht. Die Weissagung der Priesterin ist etwas Persönliches, das man einzig mit den engsten Vertrauten oder der eigenen Familie teilt – wenn überhaupt. Ich habe lediglich einer Person vom Wortlaut meiner Weissagung berichtet.
Obwohl Garreth meinen inneren Zwiespalt bemerkt haben muss, spricht er weiter. »Meine Weissagung ist etwas über sieben Jahre her. Über all die Zeit dachte ich, sie würde sich auf eine der Königstöchter beziehen, mit denen ich tagtäglich zu tun hatte. Aber wenn ich sie ansah, spürte ich nichts. Manchmal behandelten die Prinzessinnen mich wie Luft, wenn ich Glück hatte. Wenn ich weniger Glück hatte, piesackten sie mich. Ich hielt mich nur so lange wie nötig in ihrer Nähe auf. Keine von ihnen erweckte in mir das Bedürfnis, sie näher kennenlernen zu wollen. Mehr über sie wissen zu wollen – abgesehen von ihrer Krankheitsgeschichte.«
»Willst du damit andeuten, dass deine Weissagung … falsch ist?«, hake ich vorsichtig nach.
Allein dieser Gedanke grenzt an Ketzerei. Die Weissagung der Priesterinnen ist nicht nur etwas Persönliches, sondern auch heilig. Eine winzige Gnade der Götter, die noch auf unserer Welt existiert, nachdem sie uns sämtliche Magie genommen haben. Manchmal sprechen die Priesterinnen in Rätseln, oder derjenige, dem die Weissagung zuteil wird, kann sie nicht gänzlich deuten.
Aber niemand würde offen zugeben, dass seine Weissagung falsch sei. Das würde bedeuten, an den Göttern selbst zu zweifeln.
Ich habe meine Weissagung in jugendlichem Trotz gehasst, weil in ihr keine Rede von großen Taten und Eroberungen war, wie ich insgeheim gehofft hatte, sondern von meinem Schicksalsgebundenen handelte. Liebe und Beziehungen hatten in meinem damaligen Leben keinen Platz; allein meine Ausbildung zählte. Deshalb wollte ich davon nichts hören. Aber ich hätte niemals gegenüber jemandem zugegeben, dass meine Weissagung falsch sein könnte.
Nur einen einzigen winzigen Moment zweifelte ich. Und prompt verschwand mein Schicksalsgebundener spurlos. Ich hätte es besser wissen müssen, als mich zu ketzerischen Gedanken hinreißen zu lassen! Dennoch kamen sie mir in den Sinn. Heute verfluche ich mich dafür, haben sie mir doch den einzigen Mann genommen, dem je mein Herz gehört hat.
Ich halte die Luft an, während ich auf Garreths Antwort harre. Was werde ich tun, wenn er sich als Ketzer erweist?
Es gibt nicht viele Dinge, vor denen ich Angst habe, aber ich fürchte den Zorn der Götter. Ich ängstige mich davor, dass er auch mich treffen könnte, wenn ich mich weiter in Garreths Nähe aufhalte, sollte er sich als Ketzer entpuppen. Eine Kostprobe des göttlichen Zorns hat mein ganzes Dasein auf den Kopf gestellt. Zwar dachte ich, alles verloren zu haben, doch etwas besitze ich noch: mein Leben. Die Götter sind nicht dafür bekannt, mit einem menschlichen Leben zimperlich umzugehen.
»Meine Weissagung ist nicht falsch«, sagt Garreth, nachdem er mich eine gefühlte Ewigkeit hat zappeln lassen. »Ich habe sie bloß … falsch interpretiert. Als Heiler am Königshof bin ich ständig von jenen mit königlichem Blut umgeben. Ich dachte, es müsse zwingend eine der dort lebenden Prinzessinnen sein, auf die meine Weissagung sich bezieht.« Er seufzt. »Wenn sie mich herablassend behandelten, gab es Zeiten, in denen ich mir wünschte, meine Weissagung wäre falsch, das gebe ich zu. Ich hätte mich lieber von den Burgmauern gestürzt, als mein Leben mit einer dieser verzogenen Gören teilen zu müssen.«
»Dir ist klar, dass du ziemlich ketzerisch klingst?«, grummele ich.
»Verzeih. Normalerweise … rede ich nicht darüber. Selbst meinen Eltern habe ich nie von meinen Sorgen erzählt – aus Angst, dass sie mich als Ketzer verstoßen könnten. Ich möchte nicht, dass du diesen Eindruck von mir hast. Deshalb bitte ich dich, dir meine Geschichte bis zu Ende anzuhören.«
»Na schön. Erzähl mir mehr.«
Es ist lange her, seitdem ich eine normale Unterhaltung mit jemandem geführt habe. Das letzte Mal muss es mit Batur gewesen sein – bevor ich eines Morgens ohne meinen Schicksalsgebundenen aufwachte. Mich nun mit Garreth zu unterhalten, beruhigt meine Gedanken, die, wann immer ich körperlich zur Ruhe komme, zu Batur wandern wollen. Sie beschäftigen sich unablässig mit der Frage, ob es tatsächlich der Zorn der Götter über mein ketzerisches Aufbegehren war oder ob … es meine Schuld war.
Habe ich etwas falsch gemacht? Mich in irgendeiner Situation ungeschickt angestellt? Ihn nicht genügend befriedigt? Hat ihn mein Verhalten oder mein Unwissen abgeschreckt? Dabei habe ich mich so bemüht … Nachdem ich fast mein ganzes Leben nichts sehnlicher wollte, als ein Junge zu sein, konnte ich mich bei Batur zum ersten Mal wie eine Frau fühlen.
Doch offenbar habe ich mich zu ungeschickt in dieser – für mich neuen – Rolle angestellt.
Garreths Blick gleitet ins Leere. »Ich habe ebenso wie du eine Abneigung gegen Ketzer, musste ich in der Hauptstadt doch mehrmals miterleben müssen, wie die Priester diejenigen geholt haben, die ketzerische Reden verbreitet haben. Ich kenne sogar einen Heiler, der hinzugerufen wurde, um den Ketzer mittels Tränken so lange wie möglich am Leben zu erhalten, damit die Priester ein Exempel an ihm statuieren konnten. Sosehr ich Ketzer auch verabscheue, dieser Mann tat mir leid. Und der Heiler ebenfalls. Er wurde … nie wieder derselbe.«
Ich nicke nachsichtig. »Ein Grund mehr, weshalb du aufpassen solltest, was du sagst.«
»Du hast recht. Aber sei versichert: Ich bin kein Ketzer. Ich habe angesichts meiner Möglichkeiten nur mit meinem Schicksal gehadert, hätte aber die Weisheit der Götter niemals infrage gestellt.«
»Ich kenne dieses Gefühl«, gebe ich leise zu. »Welche der Prinzessinnen ist es nun geworden?«
»Keine aus Bellvor«, antwortet Garreth. »Eines Tages kam eine Delegation aus dem Küstenreich Valencia in die Hauptstadt. Der dortige Herrscher war unter dieser Delegation – und mit ihm seine Tochter.«
Jedwedes Misstrauen gegenüber seiner Ansicht zu seiner Weissagung verpufft. Ich habe bereits mehrmals gehört, dass die Weissagung oft Spielraum für Interpretationen lässt. Bei meiner ist das nicht der Fall, aber bei Garreths offensichtlich schon.
Valencia. Das südlichste der vier Reiche liegt direkt am Meer. Ich habe noch nie einen Valencianer mit eigenen Augen gesehen, aber viele Geschichten über sie gehört. Es heißt, sie haben sich ihrer Nähe zum Meer angepasst, sodass sie auch unter Wasser atmen können. Und die Valencianerinnen sollen eine solch liebreizende Stimme besitzen, dass sie mittels eines einzigen Wortes jeden um den kleinen Finger wickeln können.
»Ihr Name ist Ragna.« Garreths Stimme klingt nun so weich und liebevoll, dass mir ganz warm ums Herz wird. »Sie ist wunderschön und anmutig. Ich konnte nicht viel Zeit in ihrer Nähe verbringen, doch während dieser kostbaren Minuten hat sie mich nicht derart abweisend behandelt wie die hiesigen Prinzessinnen.«
Ich schenke ihm ein Lächeln. Ihn bloß von seiner Angebeteten reden zu hören, lässt mich seine Gefühle für sie spüren. Vor einigen Jahren hätte ich wahrscheinlich nicht mehr als ein Kopfschütteln für ihn übrig gehabt, doch nun, nachdem ich selbst erfahren habe, was Liebe ist, verstehe ich ihn. Ich habe am eigenen Leib gespürt, dass dieses Gefühl, über das ich mich jahrelang lustig gemacht habe, einen selbst die schlimmste Strafe überstehen lassen kann.
Nichtsdestoweniger schleichen sich Bedenken in mein Verständnis.
»Dennoch«, sage ich, »ist diese Ragna eine Prinzessin. Du magst ein fähiger Heiler sein, trotzdem wird die Hand einer Prinzessin weit außerhalb deiner Möglichkeiten liegen. Sicherlich ist Ragna bereits einem anderen versprochen.«
Ein seliges Lächeln breitet sich auf Garreths Lippen aus. »Nein, ist sie nicht.«
Ich warte darauf, dass er weiterspricht. Zwar habe ich mich nie für Politik und die Geschäfte der Adligen interessiert, aber selbst mir ist klar, dass eine Prinzessin vorrangig die Aufgabe hat, den angeschlagenen Frieden zwischen den Reichen zu sichern. Deshalb werden bereits früh und ohne die Einwilligung der beiden Beteiligten Ehen ausgehandelt. Ein jeder hat in unserer Gesellschaft eine Aufgabe zu erfüllen, und bei dieser Erfüllung hilft ihm oft die Weissagung der Götter. Die valencianische Prinzessin wird dabei keine Ausnahme bilden. Falls in ihrer Weissagung keine Rede von einer vorteilhaften Ehe zwischen den Völkern ist, werden ihre Eltern dennoch eine arrangieren – weil es der Lauf der Dinge ist.
»Prinzessin Ragna«, sagt Garreth endlich, »ist das einzige Kind des Königs von Valencia. Er liebt seine Tochter abgöttisch und kann ihr keinen Wunsch abschlagen. Auch den nicht, dass sie sich selbst einen Mann erwählen darf. Meine Chancen stehen also gar nicht so schlecht. Das dachte ich zumindest, bis ich bei ihren Dienern aufschnappte, wie sie ihren Mann wählen will.«
Ich nicke bedächtig. Würde mein Vater noch leben, hätte er vielleicht einem ähnlichen Abkommen zugestimmt, wenn ich ihn darum gebeten hätte. Denn auch ich war sein einziges Kind. Seine geliebte Tochter, der er jeden Wunsch von den Augen abgelesen hat. Bloß weil Ragnas Vater ein König ist, muss es nicht bedeuten, dass er seiner Tochter diesen Gefallen nicht gewähren kann.
»Es werden viele Männer um sie anhalten«, sage ich. »Adlige wie Bürgerliche, wenn sie aus freien Stücken wählen darf und die Herkunft kein Ausschlussgrund ist.«
»Ihr Vater hat wohl versucht, ihr ein paar potenziell günstige Junggesellen schmackhaft zu machen.« Erneut rutscht Garreth unwohl auf seinem Platz herum. »Aber sie lehnte alle ab. Sie will nur denjenigen als ihren zukünftigen Mann anerkennen, der ihr das sagenumwobene Schwert Caligram bringt.«
Ich seufze geräuschvoll. Daher weht also der Wind … Deshalb will Garreth unter allen Umständen dieses verdammte Schwert haben, das seit Ewigkeiten in einem Stein steckt und objektiv gesehen keinerlei Wert besitzt.
»Ihr Vater stimmte zu«, sagt er. »Schließlich gilt Caligram als Symbol des Friedens.«
Ein Schwert, dessen Name übersetzt so viel wie »Blutschmerz« bedeutet, kann nur schwerlich ein Symbol des Friedens sein, doch ich verkneife mir diese Bemerkung. Es steht einzig und allein für Macht, denn es gehörte dem einzigen Mann, dem es gelang, alle Reiche unter seiner Herrschaft zu vereinen – zumindest kurzfristig. Das einst einige Reich wurde in vier Gebiete zerschlagen, und es gab seitdem keinen einheitlichen Herrscher mehr. Gerüchten zufolge soll derjenige, der das Schwert aus dem Stein ziehen kann, fähig sein, die Reiche wieder zu einen.
Ich halte das für nichts weiter als das Wunschdenken des einfachen Volkes. Ein Schwert, noch dazu eines, das seit Jahrhunderten der Witterung ausgesetzt ist und vor sich hinrostet, wird niemanden dazu ermächtigen, alle vier Reiche zu einen, deren Lieblingsbeschäftigung es ist, sich gegenseitig das Leben schwerzumachen.
Wenn ich daran denke, dass auch ich einst dieses Schwert als etwas Wertvolles betrachtet haben, dank der Geschichten meines Vaters, möchte ich angewidert das Gesicht verziehen. Wie naiv ich doch als Kind war! Heute weiß ich es zum Glück besser.
»Glaubst du, dass Caligram dich dazu ermächtigt, ein Herrscher zu sein?«, frage ich.
»Ich will kein Herrscher sein«, murmelt Garreth mehr zu sich selbst. »Ich bin zufrieden mit meinem Leben, wie es ist. Aber ich will … Prinzessin Ragna. Und dazu brauche ich Caligram. Dann wird sie mich zu ihrem Mann machen. Und meine Weissagung wird sich erfüllen.«
Ich will ihm nicht die Hoffnung nehmen, deshalb presse ich fest die Lippen aufeinander. Ehen sind bereits aus weit weniger guten Gründen geschlossen worden; damit habe ich kein Problem. Die Schwachstelle seines Plans ist das Schwert selbst. Es wird einen Grund geben, warum es bis heute niemandem gelungen ist, es herauszuziehen. Auch uns wird es nicht gelingen. Aber Garreth wird sich davon nicht entmutigen lassen. Er wird so lange nach neuen Freiwilligen suchen, bis er denjenigen gefunden hat, der es fertigbringt.
Oder bis seine finanziellen Mittel erschöpft sind.
Ich tippe darauf, dass Letzteres zuerst eintreten wird.
»Wie lange versucht du schon, an das Schwert zu gelangen?«, frage ich.
»Einige Monate«, gibt er zu. »Als Prinzessin Ragna abgereist ist, habe ich mich sofort aufgemacht, um das Schwert herauszuziehen. Aber es … gelang mir nicht. Also heuerte ich die kräftigsten Söldner an, die ich finden konnte, doch auch sie scheiterten. Aber ich gebe nicht auf!« Er schnaubt. »Und wenn ich jeden Bewohner Bellvors und der anderen Reiche dafür anheuern muss … Ich werde es bekommen!«
Seufzend reibe ich mir über die Stirn. »Dann können wir froh sein, dass deine Prinzessin die Wahl ihres Gatten nicht daran geknüpft hat, wer das Schwert herauszieht, sondern wer es ihr bringt. Denn ich habe keine Lust, Ragna zu heiraten.«
Sofort hellt sich seine Miene auf. »Heißt das, du nimmst meinen Auftrag an?«
Ich wische mir die rechte Hand am Hosenbein ab, ehe ich sie ihm hinhalte. »Ich werde dich zum See und dem Schwert bringen und auf dich aufpassen. Und ganz vielleicht werde ich versuchen, es herauszuziehen. Aber danach …«
Er schlägt ein. »Danach wirst du dich wieder auf die Suche nach deinem Schicksalsgebundenen machen. Und vielleicht kann ich dir dabei helfen. Wir Eslinger unterhalten ein ganz gutes Netzwerk in Lerthau. Wenn er sich irgendwo verletzt hat und seine Wunde behandeln ließ, dann wird er auf jemanden aus meiner Familie getroffen sein.«
Ich hoffe nicht, dass Batur sich verletzt hat, aber nach Wochen, die ich ohne Perspektive in einem dunklen Loch sitzend zugebracht habe, erscheint mir jeder noch so kleine Lichtstrahl wie die Sonne.
Zwar glaube ich keine Sekunde daran, dass ich das Schwert aus dem Stein ziehen kann, doch den Rest meines Auftrags werde ich so gut erfüllen, wie ich nur kann.
Denn Garreth hat mir die Hand gereicht und mich aus diesem Loch gezogen, aus dem ich allein womöglich nie hätte herausklettern können. Das ist weit mehr, als ein anderer Mensch seit sehr langer Zeit für mich getan hat.